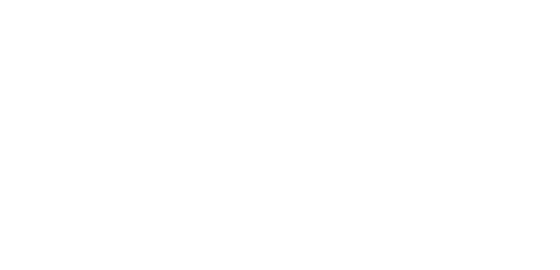Pressemitteilung
Bauernopfer: Bundesregierung nimmt Fischern die Kompensationsmöglichkeit für Fanggebietsverluste durch Offshore-Windparks
Kabinettsbeschluss könnte rechtswidrig sein
Spontane Fischerproteste in Fedderwardersiel, Büsum und vor Amrum
Im Rahmen der Energiewende betreibt die Bundesregierung den massiven Ausbau von Offshore-Windenergie. Die Fischerei verliert dadurch einen großen Teil ihrer Fanggebiete. Im Rahmen der Bundeskompensationsverordnung wurden Regelungen verschiedenster Art zur Kompensation getroffen. Dabei ist die Fischerei aus rechtlichen Gründen nicht angemessen berücksichtigt worden. Verantwortungsvolle Entscheidungsträger wollten eine faire Ausgleichsmöglichkeit schaffen. Im Rahmen des Windenergie-auf-See-Gesetzes (WindSeeG) wurde deshalb festgelegt, dass von zukünftigen Versteigerungserlösen 10 % für Maßnahmen zur umweltschonenden Fischerei und 10 % für Meeresnaturschutz eingesetzt werden. Dieser für Kompensationszwecke vorgesehene Betrag wurde vor gut einem Jahr durch eine Änderung des WindSeeG bereits auf 5 % halbiert.
Jetzt soll gemäß Kabinettsbeschluss zum Haushalt 2024 der Umfang der Mittel für die Fischerei noch einmal um 80 % gekürzt werden, so dass nur noch 1 % der Versteigerungserlöse für Maßnahmen zur umweltschonenden Fischerei zur Verfügung stehen würden. Die Mittel für Meeresnaturschutz sollen lediglich um 37,5 % gekürzt werden.
Der Zweck der ganzen Regelung, zumindest eine Anpassung der Fischerei an die neuen Verhältnisse nach dem Ausbau der Windenergie in der Nordsee zu ermöglichen, wird durch die jetzt vorgesehene Umwidmung der Mittel nicht mehr erfüllbar sein. Die energetische Transformation des Sektors zu fossilfreien Schiffsantrieben wird ebenfalls nicht mehr möglich sein.
Um die Zweckentfremdung überhaupt zu ermöglichen, wird mit dem Haushaltsgesetz 2024 das WindSeeG geändert. Eine Beteiligung des Sektors und ein qualifizierter Austausch von Argumenten hat in keiner Weise stattgefunden. Bereits im Oktober vergangenen Jahres haben die Fischereiorganisationen dem BMEL inhaltliche und strukturelle Konzepte vorgestellt, die einen effizienten Einsatz der Mittel im Umfang von 5 % ermöglicht hätten. Dabei geht es nicht um „zukünftige Fördermöglichkeiten“ im Sinne von Subventionen, wie BMEL es darstellt, sondern um eine Kompensation für Fanggebietsverluste und die Anpassung des gesamten Sektors an die industrialisierte Nordsee.
Die Kabinettsvorlage enthält zudem eine nach Auffassung von Experten rechtswidrige Zuführung der Mittel in den regulären Haushalt des BMEL, weil von den Restmitteln der Fischerei noch 25 Millionen für nachgeordnete Behörden des BMEL (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), Thünen-Institut (TI)) abgezweigt werden sollen. „Das wird juristisch geprüft, und dagegen wird geklagt, wenn es den Abgeordneten im Haushaltsausschuss nicht gelingt, hier noch etwas zu ändern“, kündigt Dirk Sander, Vorsitzender des Verbandes der Kutter- und Küstenfischer, an. „Wenn man dem Fischer die Fanggebiete nimmt, ist das so, als wenn man dem Bauern den Acker wegnimmt. Hier werden jetzt willkürliche Entscheidungen ohne Konsultation mit den Betroffenen getroffen. Es ist geradezu lächerlich, wenn man bedenkt, wie sich die Grünen früher als die Vorkämpfer für Transparenz und Bürgerbeteiligung gebärdet haben“, stellt Dirk Sander fest. „Da wird vom Minister behauptet, es wäre ein Kompromiss, aber mit uns hat keiner geredet. Die Grünen handeln die Kompromisse wohl am liebsten mit sich alleine aus.“
Nach Bekanntwerden der Pläne der Bundesregierung gab es spontane Veranstaltungen mit Kutterfahrten in Fedderwardersiel, Büsum und auf Amrum. Außerdem beteiligten sich die Fischer an den Veranstaltungen der Bauern, Trucker und Handwerker in der Küstenregion.
Auch dass der Meeresnaturschutz deutlich weniger (nur um 37,5 %) gekürzt werden soll und damit mehr als das Dreifache der Mittel der Fischerei vom Versteigerungserlös der Flächen erhalten soll, nämlich 3,125 %, ist ein weiterer Schlag ins Gesicht der arbeitenden Menschen.
Kontakt: Claus Ubl 0176 – 832 10 604