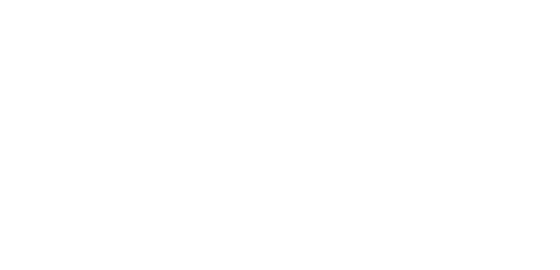Pressemitteilung
Aktionswoche ab 8. Januar: Fischerei solidarisiert sich mit Landwirten und Fuhrunternehmen
Empörung über die Zweckentfremdung der Ausgleichsmittel für Fanggebietsverluste durch Offshore-Wind-Ausbau
Auf örtlicher Ebene gab es spontane Unterstützung und Kooperation bei der Planung von Aktionen in der Aktionswoche. Die Fischerei hat den Wegfall des „Agrardiesel“ und der
Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge abgelehnt. Auch die Maut-Erhöhung im Güterverkehr wird von der Fischerei abgelehnt.
Die Fischer werden sich vielfältig an den Aktionen beteiligen. Sie werden unter anderem an der großen Abschlussdemonstration in Berlin am 15. Januar teilnehmen. Auch bei der Sternfahrt nach Berlin am 18. und der Kundgebung am 19. Januar werden die Fischer dabei sein.
„Die Regierung sagt immer, die Dieselpreise sollen steigen, damit man Anreize hat, auf erneuerbare Energie umzusteigen. Es gibt aber keine elektrischen Traktoren oder Mähdrescher, auf die Landwirte umsteigen können. Und die LKW-Mauterhöhung gilt gleichermaßen für Diesel wie für Elektro-LKW. Das erscheint alles wie konzeptionsloses Abkassieren“, stellte ein Branchenvertreter fest. Agrarsubventionen sind immer auch Subventionen der Verbraucherpreise.
Kostensteigerungen im Transportwesen belasten jeden Verbraucher. Alle Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs werden mit dem LKW transportiert. Diese Kostensteigerungen gehen zu Lasten der Verbraucher und wirken als weitere Verschlechterung des Wirtschaftsstandortes Deutschland.
Die Bundesregierung hat gestern verkündet, die Kostenbelastung für die Landwirtschaft zur Haushaltskonsolidierung teilweise zurückzunehmen.
Die Haushaltslücke soll stattdessen mit den Mitteln geschlossen werden, die für die Fischerei vorgesehen waren. Diese stammen gemäß Windenergie-auf-See-Gesetz aus der Auktion von Nordsee- und Ostsee-Flächen, die für den Bau von Offshore-Windparks genutzt werden sollen und damit für die Fischerei als Fanggebiete verloren gehen. Mit diesen Geldern soll es eine Anpassung der Flotte an die neue Situation mit stark verringerten Fanggebieten geben. Die Transformation der Flotte zu fossilfreien Antrieben soll damit ebenfalls ermöglicht werden. Auch eine Entschädigung für den Verlust der Gebiete ist aus Sicht des Sektors erforderlich „Was da gerade auf der Nordsee passiert, ist so, als würde man dem Bauern seinen Acker wegnehmen, denn in den Offshore-Windparks wird Fischerei komplett verboten. Außerdem werden die Kabeltrassen zur Küste gesperrt. Fanggebiete sind die Existenzgrundlage der Fischerei. Und jetzt soll das Geld für die Entschädigung und Anpassung zum Stopfen von Haushaltslöchern der Bundesregierung zweckentfremdet werden“, fasst der Vorsitzende Dirk Sander den Ärger in der Branche zusammen.
Es gibt auch erhebliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der aktuellen Entscheidung zu der Zweckentfremdung der Fischerei-Mittel für den Bundeshaushalt. Die Verwendung der Mittel ist durch §58 des Windenergie-auf-See-Gesetzes eindeutig festgeschrieben. Wenn im Haushaltsgesetz eine andere Verwendung genannt wird, als es im Windenergie-auf-See-Gesetz vorgeschrieben ist, kann das einen erneuten Rechtsbruch darstellen. Der Bundestag kann das Windenergie auf See-Gesetz natürlich ändern, aber es stellt sich die Frage, ob das so einfach rückwirkend gemacht werden kann oder ob es dann nur für zukünftige Flächenversteigerungen gelten würde. Auf jeden Fall müsste es ein ordentliches Gesetzgebungsverfahren im Bundestag geben mit Beachtung von Beteiligungsrechten und Fristen.
Kontakt: Claus Ubl 0176 – 832 10 604